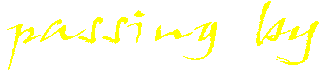| „Nature“-Publikation:
Studie von Wissenschaftlern der Universitäten Regensburg
und Jena weist erstmals lernbedingte strukturelle Veränderung
im menschlichen Erwachsenenhirn nach.
Was
die Hirnstrukturen betrifft war man bisher davon ausgegangen,
dass Erwachsenenhirne keinen wesentlichen Zuwachs an grauen
Zellen mehr erhalten, sondern sich lediglich altersbedingt
oder durch Krankheit zurückbilden. Wissenschaftler von
der Universität Regensburg und der Universität Jena
konnten nun erstmals in einer Studie nachweisen, dass sich
auch Erwachsenenhirne bei entsprechendem Training noch verändern.
Die Ergebnisse erscheinen am 22. Januar in der neuesten Ausgabe
der renommierten internationalen Fachzeitschrift Nature.
Das
Team um den Regensburger Neurologen PD Dr. Arne May ließ
Erwachsene (Altersdurchschnitt 22 Jahre) drei Monate lang
das Jonglieren lernen. Die 12 besten Kandidaten, die drei
Bälle mindestens 60 Sekunden lang in der Luft halten
konnten, wurden für die Studie ausgewählt. Ihre
Hirne wurden vor dem Training, direkt nach dem Training und
nach dreimonatiger Trainingspause untersucht und mit den Hirnen
untrainierter Probanden verglichen.
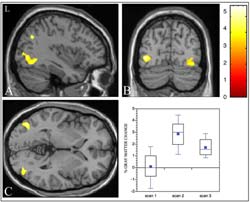 „Anfangs
ließen sich keine wesentlichen Unterschiede in der grauen
Substanz der angehenden und der Nicht-Jongleure feststellen“,
erklärt Dr. May. Nachdem jedoch die eine Gruppe innerhalb
von drei Monaten das Jonglieren erlernt hatte, ließen
diese Jongleure eine deutliche beidseitige Vergrößerung
der grauen Substanz in der linken hinteren Furche zwischen
oberem und unterem Seitenläppchen des Gehirns (im intra-parietalen
Sulcus) erkennen. Dieses Gebiet ist darauf spezialisiert,
Bewegungen von Objekten im dreidimensionalen Raum wahrzunehmen.
„Nach einer dreimonatigen Trainingspause hatte sich
diese Erweiterung teilweise wieder zurückgebildet“,
so der Studienleiter weiter. „Anfangs
ließen sich keine wesentlichen Unterschiede in der grauen
Substanz der angehenden und der Nicht-Jongleure feststellen“,
erklärt Dr. May. Nachdem jedoch die eine Gruppe innerhalb
von drei Monaten das Jonglieren erlernt hatte, ließen
diese Jongleure eine deutliche beidseitige Vergrößerung
der grauen Substanz in der linken hinteren Furche zwischen
oberem und unterem Seitenläppchen des Gehirns (im intra-parietalen
Sulcus) erkennen. Dieses Gebiet ist darauf spezialisiert,
Bewegungen von Objekten im dreidimensionalen Raum wahrzunehmen.
„Nach einer dreimonatigen Trainingspause hatte sich
diese Erweiterung teilweise wieder zurückgebildet“,
so der Studienleiter weiter.
Somit
konnte ein enger Bezug zwischen diesen strukturellen Veränderungen
und dem Erlernen von Jonglieren nachgewiesen werden, denn
die Kontrollgruppe zeigte keinerlei Veränderungen in
diesem Bereich. „Dieses Ergebnis widerlegt die gängige
Vorstellung, dass sich die anatomische Struktur des erwachsenen
Gehirns nicht mehr verändert, es sei denn durch den Alterungsprozess
oder Krankheit“, fasst der Neurologe aus Regensburg
zusammen. Die Studie belege vielmehr, dass der Lernprozess
strukturelle Veränderungen in der Gehirnrinde bewirkt.
Welche
Prozesse dabei auf der mikroskopischen Ebene ablaufen ist
noch unklar. Hier müssen histologische Untersuchungen
Aufschluss geben. Die Veränderungen im sichtbaren Bereich
könnten von einer Zunahme der Verbindungen (Synapsen)
oder der Neuriten herrühren, - den der Reizleitung dienenden
Fortsätzen der Nervenzellen. Eine weitere Möglichkeit
wäre die vermehrte Zellentstehung bei der Stützsubstanz
(Glia) oder den Neuronen.
Die
beobachteten Veränderungen fanden weniger im motorischen
als vielmehr im visuellen Bereich der Hirnrinde statt, wo
es um das Erfassen von räumlichen Bewegungsabläufen
geht. Schlaganfall-Patienten mit einer Läsion in dieser
Region sind bewegungsblind, die Bewegung z. B. eines vorbeifahrenden
Autos erscheint für sie wie „eingefroren“.
Die zweite bei den Jongleuren veränderte Region (intra-parietaler
Sulcus) ist für das Ergreifen von Gegenständen verantwortlich.
Wie das Anwachsen der Areale für das Bewegungssehen beweist,
liegt die Schwierigkeit beim Jonglieren offenbar darin, die
Bewegung der Bälle visuell zu erfassen und zu analysieren.
Um
die Veränderungen im Hirn zu lokalisieren und darzustellen,
wurden Aufnahmen der Hirne mittels Magnetresonanztomographie
(MRT) angefertigt und Ebene für Ebene analysiert . Die
Messungen und Auswertungen wurden in enger Zusammenarbeit
mit Dr. Christian Gaser von der Friedrich-Schiller-Universität
Jena durchgeführt. Der Ko-Autor aus Jena brachte seine
Kompetenzen als Elektrotechniker und Spezialist für voxelbasierte
Morphometrie ein. So heißt die Methode, mit der dreidimensionale
Hirnlandschaften am Computer dargestellt werden. Gaser, der
an Klinik für Psychiatrie der Universität Jena arbeitet,
entwickelt derzeit die Mess-Methode weiter. Zukünftig
sollen mittels deformationsbasierter Morphometrie kleinste
Änderungen in den interessanten Hirnregionen im Zeitverlauf
nachgewiesen werden.
Stefanie
Hahn, Universität Jena
Rudolf F. Dietze, Universität Regensburg
Quelle: Pressemitteilung
Universität Regensburg (21. Januar 2004)
Studie Veröffentlicht bei: Nature
Publishing Group (Nature, Bd. 427, S. 311)
Ähnliche Pressemitteilungen: Uni
Jena, Focus
Online, Süddeutsche
Zeitung, Berliner
Zeitung, ...
|